Sowohl für Unternehmer im Geschäftsleben als auch für Verbraucher im Alltag ist es wichtig zu wissen, wie lange Ansprüche aus Forderungen gültig sind, und wann solche Ansprüche verjähren. Im folgenden Artikel erhalten Sie einen Gesamtüberblick zu den Verjährungsbestimmungen und -fristen von Forderungen.
- Regelfrist: Die Regelverjährungsfrist für Ansprüche aus Forderungen beträgt gemäß § 195 BGB drei Jahre und gilt sowohl für Gläubiger als auch für Schuldner.
- Andere Frist nach Gerichtsurteil: Bei rechtskräftig festgestellten Forderungen durch Urteile oder Vollstreckungsverfahren beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre.
- Beginn: Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende des Jahres, an dem die Forderung gestellt worden ist.
- Verjährung wird nicht automatisch berücksichtigt: Die Verjährung muss eigenständig eingebracht werden, um rechtlich berücksichtigt zu werden.
- Hemmung: Die Verjährungsfrist kann gemäß § 203 BGB unter bestimmten Umständen gehemmt werden.
- Steuerschulden: Forderungen wie Steuerschulden haben eine Verjährungsfrist von fünf Jahren.
- Krankenkassen: Forderungen der Krankenkassen haben eine Verjährungsfrist von vier Jahren.
Allgemeines zur Verjährung
Die Verjährung bedeutet nicht, dass ein Anspruch (z. B. aus einer Forderung) erlischt, sondern dass die Durchsetzbarkeit des Anspruchs nach Ablauf einer bestimmten Frist (Verjährungsfrist) verweigert werden kann.
Die Einbringung der Verjährung zählt dabei zu den Leistungsverweigerungsrechten. Gemäß § 214 BGB kann ein Schuldner nach Ablauf der gesetzlichen Frist die Einrede der Verjährung einbringen um die Leistungserbringung dauerhaft zu verweigern.
Die Regelverjährungsfrist
Forderungsansprüche aus Kaufverträgen, Werkverträgen und Darlehensverträge können nicht ewig geltend gemacht werden. Mit Beginn des Jahres 2002 wurden gemäß § 195 BGB die einheitlichen Bestimmungen zur Verjährung eingeführt (Regelfrist). Davor haben sich die Verjährungsfristen an den jeweiligen Forderungen orientiert, sodass unterschiedliche Fristen gegolten haben.
Demnach gilt für Forderungen jeglicher Art eine Verjährungsfrist von drei Jahren, sodass nach dieser Frist keine Ansprüche mehr geltend gemacht werden können.
Gemäß § 199 Abs. 1 BGB beginnt die dreijährige Verjährungsfrist mit dem Ende des Kalenderjahres, in dem der Forderungsanspruch entstanden ist.
Beispiel für das Einsetzen der Verjährungsfrist:
- Eine Forderung aus einem Mietvertrag entsteht am 01.05.2017.
- Die Verjährungsfrist beginnt am 31.12.2017.
- Der Anspruch verjährt am 01.01.2021.
Wenn eine Verjährungsfrist gehemmt wird, dann wird die Zeit der Verjährung gestoppt, solange der Hemmungsgrund besteht. Das heißt, dass die Zeit in der ein Hemmungsgrund besteht nicht mitgerechnet wird.
- Verhandlungen
Gemäß § 203 BGB wird die Verjährung gehemmt, wenn Schuldner und Gläubiger noch über die Rechtmäßigkeit des Anspruches verhandeln. - Zustellung einer Klage
Wird eine Widerspruchsklage gegen eine Forderung eingereicht, so wird die Verjährung gehemmt, bis ein rechtsgültiges Urteil ausgesprochen ist. - Zustellung eines Mahnbescheids
Wird ein Mahnbescheid zugestellt, so wird die Verjährung für mindestens 6 Monate gehemmt. - Zustellung einer Streitverkündung
Die Streitverkündung ist die förmliche Benachrichtigung eines Dritten über den Vorprozess um ihn am Rechtsstreit zu beteiligen. Ergibt sich im Rahmen eines Vorprozesses eine Teilschuld eines Dritten, so wird er durch eine Zustellung einer Streitverkündung in den Rechtsstreit eingebunden. Wie das Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom 06.12.2007 (Aktenzeichen IX ZR 143/06) klargestellt hat, ist eine Hemmung der Verjährung nur dann wirksam, wenn die Streitverkündung zulässig ist. - Zustellung eines Antrags zur Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens
Das selbstständige Beweisverfahren ist ein Antragsverfahren mit dem Ziel, die Klage vorzubereiten und den Prozess zu beschleunigen, indem beispielsweise die Beweise gesichert und dokumentiert werden. Gemäß § 477 Abs.2 BGB sowie § 639 Abs.1 BGB wird die Verjährung bei einem selbstständigen Beweisverfahren so lange gehemmt, bis die abschließende gerichtliche Verfügung erfolgt ist. In der Regel endet die Hemmung mit dem Eingang des schriftlichen Gutachtens des Sachverständigen. - Einreichung eines Güteantrags
Wird ein Antrag auf eine außergerichtlichen Einigung bei einer Gütestelle (Einigungsstelle der Landesverwaltung oder der Industrie- und Handelskammer) eingereicht um einen Rechtsstreit zu schlichten, so wird gemäß §§ 209 Abs. 2, 212a BGB die Verjährung gehemmt. - Leistungsverweigerungsrecht
Gemäß § 205 BGB führt eine rechtmäßige Leistungsverweigerung zur Hemmung der Verjährung. - Höhere Gewalt
Ist die Rechtsverfolgung wegen höherer Gewalt nicht möglich, so tritt gemäß § 206 BGB eine Hemmung der Verjährung ein. - Familienverhältnis
Bei Forderungen zwischen Eheleuten (gemäß § 207 BGB), ist die Verjährung geremmt, solange sie verheiratet sind. Zwischen Eltern und Kindern ist die Verjährung gehemmt bis das Kind das 21. Lebensjahr erreicht hat. - Sexuelle Selbstbestimmung
Bei Schadensersatzforderungen aus einem Eingriff in die sexuelle Selbstbestimmung gemäß § 208 BGB, ist die Verjährung gehemmt, bis das Opfer das 21. Lebensjahr vollendet hat. Forderungen der Opfer von Sexualstraftaten gegen Minderjährige Personen verjähren also erst frühestens mit der Vollendung des 24. Lebensjahres.
Neubeginn der Verjährung
Ein „Neubeginn der Verjährung“ beschreibt den Neustart einer Verjährungsfrist unabhängig von der bereits vergangen Zeit. Das heißt, dass die abgelaufene Zeit nicht angerechnet wird. Dabei setzt der Neubeginn der Verjährung (gemäß dem Urteil des BGH vom 08.01.2013 – VIII ZR 344/12) dann ein, wenn die Verjährung schon im Gang ist.
- Anerkennung des Anspruchs durch Leistung von Teilzahlungen, Zinszahlungen oder andere Sicherheitsleistungen
Zahlt ein Schuldner einen Teilbetrag der Gesamtschuld, so ist das als Anerkennung des Anspruchs zu verstehen und führt somit zu einem Neubeginn der Verjährung. - Beantragung oder Durchführung eines Vollstreckungsverfahrens
Besonders bei Gerichtsurteilen, Vollstreckungsbescheiden, Vollstreckungsverfügungen, vollstreckbaren Vergleichen und Ansprüchen aus dem Konkursverfahren (Insolvenzverfahren) wird ein Neubeginn der Verjährung wirksam. Wird gemäß § 212 BGB der Vollstreckungshandlung wegen rechtlichen Mangels oder auf Antrag des Gläubigers nicht stattgegeben, so wird der Neubeginn aufgehoben.
Weitere Informationen zur Hemmung und Neubeginn der Verjährung finden Sie in unserem Ratgeber:
Allgemeines zu Forderungen
Eine Forderung ist der Anspruch eines Gläubigers gegenüber einem Schuldner. Eine Forderung entsteht, wenn eine vereinbarte Leistung und die entsprechende Gegenleistung nicht zeitgleich entrichtet werden. Entstandene Ansprüche aus einer vertraglichen Vereinbarung in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen werden demnach als Forderung bezeichnet.
Die Forderung im BGB
Juristisch ist eine Forderung ein schuldrechtlicher bzw. vertraglicher Anspruch, der aus einem Schuldverhältnis (wie einem Kauf-, Miet- oder Werkvertrag) entsteht.
Beispiel für das Entstehen einer Forderung:
Wird zum Beispiel ein Möbelstück geliefert, ohne bezahlt worden zu sein, so entsteht eine Forderung beim Möbel-Lieferanten gegenüber dem Verbraucher. Diese besteht, bis die offene Rechnung beglichen wird.
Die Forderungen im HGB
Bei Unternehmen werden Forderungen als Verbindlichkeiten definiert, die gegenüber einem Schuldner geltend gemacht werden. Gemäß den Bestimmungen des HGB (Handelsgesetzbuch) werden die Unternehmen verpflichtet, alle Forderungen – unter dem Posten „Umlaufvermögen“ – in der Jahresbilanz aufzulisten.
- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gemäß §266 Abs. 2B II 1 HGB.
Wird zum Beispiel eine Ware von einem Unternehmen geliefert und per Ratenzahlungsvereinbarung beglichen, so entsteht eine offene Forderung, die besteht, bis die Gesamtrechnung beglichen wird.
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen gemäß §266 Abs. 2B II 2 HGB“ target=“_blank“ rel=“nofollow“>§266 Abs 2B II 2 HGB.
Erhält beispielsweise ein Unternehmen von seinem Mutterunternehmen eine Lieferung auf Kredit, so entsteht eine Forderung vom Mutterunternehmen gegenüber dem Tochterunternehmen bis der gesamte Kaufbetrag entrichtet wird.
- Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht gemäß §266 Abs. 2B II 3 HGB.
Wenn beispielsweise ein Unternehmen eine Lieferung auf Kredit billigt, für einen Unternehmen an dem es durch Anteile beteiligt ist, so muss das separat in der Bilanz aufgelistet werden.
Forderungen und Bilanzen
Forderungen sind besonders in der Bilanzrechnung wichtig. In der Bilanz sind Forderungen immer auf der Aktivseite unter dem Posten „Umlaufvermögen“ aufzulisten. Sie werden dort als „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ geführt.
Bilanz
In einer Bilanz werden alle Vermögensbestände eines Unternehmen gemäß einer gesetzlich festgelegten Gliederung (§ 266 HGB) aufgelistet. Dabei ist die Bilanz ein wichtiges Instrument um verschiedene Funktionen zu erfüllen.
- Informationsfunktion – verlässliche Informationen zur aktuellen Vermögenslage bereitstellen
- Dokumentationsfunktion – geschäftliche Abläufe nachvollziehbar dokumentieren
- Gewinnermittlungsfunktion – die tatsächlichen Gewinne eines Unternehmens dokumentieren

In der Bilanz wird zwischen der Aktiva, in der die Vermögenswerte aufgelistet werden, und der Passiva, in der aufgelistet wird, wie die Vermögenswerte finanziert worden sind, unterschieden.
- Bei Ansprüchen von einem Unternehmen gegenüber einem Verbraucher spricht man von Forderungen.
- Besteht hingegen ein Anspruch eines Verbrauchers gegenüber einem Unternehmen, so nennt man das Verbindlichkeit.
Bewertung von Forderungen
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Bewertung der Forderung, die auch gesetzlich vorgeschrieben ist. Dabei sind folgende Prinzipien bei der Bewertung einzuhalten.
- Prinzip der Einzelbewertung: Alle Forderungen müssen einzeln und individuell bewertet werden.
- Vollständigkeitsprinzip: Alle Forderungen müssen vollständig aufgelistet werden.
- Vorsichtsprinzip: Es ist untersagt die Forderungen überhöht zu bewerten.
- Niederstwertprinzip: Dieses Prinzip schreibt vor, jeweils den niedrigsten Wert zu benutzen.
Gemäß diesen Prinzipien werden die Forderungen nach der Leistungsfähigkeit und dem Leistungswillen des Schuldners in drei Bonitätsstufen unterteilt.
Uneinbringliche Forderungen
Das sind Forderungen, bei denen eine Zahlung nicht mehr erwartet werden kann.
Zweifelhafte Forderungen
Das sind Forderungen, bei denen mit Zahlungsausfällen gerechnet werden muss.
Forderungen ohne erkennbare Risiken
Das sind Forderungen, bei denen mit einer fristgerechten Bezahlung gerechnet werden kann.
Debitorenumschlag
Dieser Begriff beschreibt das Verhältnis vom Umsatzerlös zum Kapitalwert der offenen Forderung (Debitorenbestand). Mit der folgenden Formel kann die Entwicklung der Kapitalbindung an den Forderungen berechnet werden. Das heißt diese Formel gibt Auskunft über die Entwicklung des Vermögens, welches in Form von Forderungen besteht.
Debitorenumschlag = Umsatzerlöse (netto) / durchschnittlicher Debitorenbestand (netto)
Je niedriger der Wert, desto höher ist das Risiko bei Zahlungsunfähigkeit der Kunden in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten.
Je höher der Wert, desto geringer ist das Risiko bei Zahlungsunfähigkeit der Kunden in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten.
Abtretbarkeit von Forderungen
Gemäß § 398 BGB wird eine Forderung abgetreten, wenn sie durch einer vertraglichen Vereinbarung auf einen Dritten (dem Zessionar) übertragen wird. Dabei kann die Abtretungsvereinbarung als Kaufvertrag oder Schenkung geregelt werden. Beispielsweise kann eine Forderung verkauft oder auch verschenkt werden.
Im Grunde handelt es sich um eine Vereinbarung über einen Gläubigerwechsel, sodass mit dem Wirksamwerden der Abtretung der alte Gläubiger alle Rechte an der Forderung dem neuen Gläubiger übergibt.
Zessionar
Ein Zessionar ist ein Forderungserwerber, der gemäß §§ 398 ff. BGB im Rahmen eines Abtretungsvertrages eine Forderung von einem alten Gläubiger (dem Zedenten) übertragen bekommt.
Wenn beispielsweise eine Immobilie auf Kredit gekauft wird, so bleibt sie so lange im Eigentum der Bank, bis der volle Kaufpreis entrichtet wird. Innerhalb dieser Zeit kann die Bank als Gläubiger (Zedent) durch einen Abtretungsvertrag die Forderung auf eine andere Bank (Zessionar) übertragen, sodass der Schuldner dieselben Ratensätze auf ein neues Bankkonto überweisen muss.
Eine Abtretbarkeit ist möglich, wenn die Forderung besteht (d. h. nicht erloschen ist) und somit durchsetzbar ist. Auch darf sich die Abtretungsvereinbarung nicht auf den Inhalt der Forderung auswirken (der Forderungsinhalt muss immer gleich bleiben).
Gemäß § 400 BGB können nur jene Forderungen abgetreten werden, die auch pfändbar sind.
Ein Widerruf einer Abtretungsvereinbarung ist nicht möglich, jedoch kann durch einen neuen Abtretungsvertrag die Rückabtretung vereinbart werden.
Abtretungsvereinbarung Vorlage:
Unter dem folgenden Link erhalten Sie ein Muster einer Abtretungsvereinbarung nach §§ 398 ff. BGB:
Widerspruch gegen eine Forderung
Eine Forderung entsteht, wenn eine vertraglich vereinbarte Pflicht nicht fristgerecht umgesetzt wurde. Ist die vertragliche Grundlage nichtig oder unwirksam, so kann die darauf basierende Forderung angefochten und Widerspruch eingelegt werden.
- Formmängel
- Geschäftsunfähigkeit
- Scheingeschäft
- Scherzgeschäft
- Sittenwidrigkeit
- Gesetzesverstoß
Des weiteren kann ein Vertrag durch folgende Möglichkeiten aufgelöst und somit auch alle damit verbundenen Forderungen als unwirksam erklärt werden.
- Vertragslösung durch Vereinbarung
Hierbei kann eine Vertragslösung durch eine einvernehmliche Vereinbarung entschieden werden. Oder die Bedingungen eines vertraglich vereinbarten Rücktrittsvorbehalt werden erfüllt. - Vertragslösung durch Anfechtung
Bei einer Anfechtung sind die Anfechtungsgründe und die Anfechtungsfristen entscheidend. Legitime Anfechtungsgründe bestehen bei Irrtümern und bei Täuschung oder Drohung. In den Fällen von Täuschung oder Drohung hat der Antragsteller ab Bekanntwerdung ein Jahr Zeit, um den Anspruch geltend zu machen.
Nach Ablauf von 10 Jahren können keine Ansprüche mehr erhoben werden.
Muster zum Widerspruch gegen eine Mahnung / eine Rechnung:
Unter dem folgenden Link erhalten Sie ein Musterschreiben eines Widerspruchs gegen eine Mahnung:
Unter dem folgenden Link erhalten Sie ein Musterschreiben eines Widerspruchs gegen eine Rechnung:
Muster Widerspruch gegen eine Rechnung
[/info]
Verjährungsfristen von Forderungen, Schulden und Rechnungen
Generell wird unterschieden zwischen der Regelfrist von drei Jahren, den speziellen Verjährungsfristen bei bestimmten Forderungen und den Verjährungsfristen bei Mahn- und Vollstreckungsverfahren.
Im folgenden möchten wir Ihnen einen hilfreichen Überblick zu den Verjährungsbestimmungen bei bei verschiedenen Forderungen, Schulden und Rechnungen bieten.
Wann verjähren Mietschulden?
Bei Mietschulden gilt die Regelfrist von drei Jahren. Jedoch kann diese Frist verlängert werden, wenn ein Hemmungsgrund besteht. Auch hier ist es bei angehäuften Mietschulden üblich, dass eine Vollstreckungsverfügung beantragt wird, sodass die Verjährung auf 30 Jahre verlängert wird.
Wird der Forderungsanspruch anerkannt, indem ein Teilbetrag entrichtet wird, dann führt dies zum Neubeginn der Verjährung ab dem Eingang der Teilzahlung.
Wann verjähren Schulden bei der Krankenkasse?
Gemäß § 25 Abs. 1 des Vierten Sozialgesetzbuches verjähren Ansprüche auf Beiträge nach vier Jahren, wobei auch hier die Verjährungsfrist mit dem Ende des Jahres eintritt, in dem der Anspruch gestellt wurde.
Beiträge, die vorsätzlich nicht entrichtet worden sind, verjähren erst nach 30 Jahren.
Wann verjähren Schulden bei Inkassounternehmen?
Auch hierbei gilt die Regelfrist von drei Jahren, solange kein rechtswirksamer Vollstreckungsbescheid vorliegt. Sollte dies der Fall sein, verlängert sich die Frist auf 30 Jahre.
Wann verjähren Steuerschulden?
Bei Steuerschulden beträgt die Verjährungsfrist gemäß § 228 der AO (Abgabenordnung) erst nach fünf Jahren, wobei die Frist mit dem Ende des Kalenderjahres beginnt, in dem die Forderung gestellt wurde.
Zu bemerken ist hier, dass die Finanz-und Hauptzollämter als Vollstreckungsbehörden für den Eintrieb der Schulden verantwortlich sind und Vollstreckungsverfahren (wie Pfändungsverfügungen oder Arrest) einleiten können, sodass die Verjährungsfrist auf 30 Jahre verlängert werden kann.
Wann verjähren Zinsforderungen?
Bei Zinsforderungen muss man zwischen Haupt-Zinsforderung und zukünftiger Zinsforderung unterscheiden.
Die entstandene Zinsforderung bis zur gerichtlichen Feststellung des Anspruchs nennt man Haupt-Zinsforderung. Für diese Forderung beträgt die Verjährungsfrist 30 Jahre.
Die Zinsforderungen, die erst nach der gerichtlichen Feststellung entstehen, nennt man zukünftige Zinsforderungen. Für diese Forderungen gilt die Regelfrist von drei Jahren.
Wann verjähren Forderungen des Rundfunkbeitrags (GEZ-Beiträge)?
Gemäß § 7 Abs. 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags richten sich die Verjährungsbestimmungen an den Vorschriften des BGB. Das heißt, dass hier die Regelfrist von drei Jahren gilt.
Beim Eintrieb der GEZ-Gebühren automatisierte Mahn- Vollstreckungsverfahren hemmen jedoch die Regelverjährungsfrist. In der Regel wird die Forderung eingeklagt, sodass sich die Verjährung auf 30 Jahre verlängert.
Wann verjähren Stromrechnungen?
Auch hier gilt eigentlich die Regelfrist von drei Jahren.
Jedoch gibt es beim Eintritt der Frist gemäß § 17 Stromgrundversorgungsverordnung eine Sonderregelung, die besagt, dass die Verjährungsfrist mit der Erstellung der Stromabrechnung beginnt.
Dabei verpflichtet sich der Stromanbieter, die Abrechnung innerhalb eines Zeitraumes, der 12 Monate „nicht wesentlich überschreitet“, zustellen. Diese ungenaue Formulierung lässt es nicht zu, konkrete Angaben zum Eintritt der Verjährungszeit zu machen.
Wann verjähren Handwerkerrechnungen?
Bei einer Handwerkerrechnung handelt es sich um eine Forderung aus einem Kaufvertrag einer Dienstleistung, deshalb ist auch hier die Regelfrist von drei Jahren gültig.
Wann die Verjährungsfrist eintritt, ist in diesem speziellen Fall von der Fertigstellung der Arbeit bzw. der Dienstleistung abhängig, da ein Anspruch auf Zahlung der Rechnung erst mit der Beendigung der Arbeit fällig wird. Daher beginnt die Verjährungsfrist mit der Abnahme des Werkes.
Zu berücksichtigen ist, dass in den AGBs der Unternehmen eine Verjährungsfrist von 30 Jahren eingeführt sein kann.
Wann verjähren Gutscheine?
Für Gutscheine gelten dieselben Bestimmungen wie für Forderungen, sodass Gutscheine in der Regel nach drei Jahren verjähren, wobei die Verjährungsfrist mit Ende des Kalenderjahres beginnt, in dem der Gutschein gültig wurde.
Kürzere Verjährungsfristen bei Gutscheinen sind ebenfalls möglich, jedoch müssen diese ausreichend begründet werden. Bei bestimmten Dienstleistungen oder Waren kann die Erhöhung der Kosten als Begründung für eine kürzere Gültigkeit eingebracht werden.
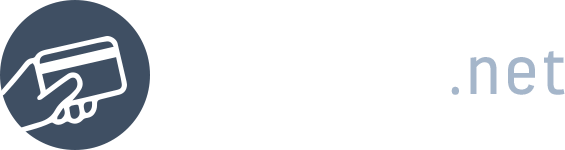





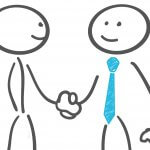
Ich hatte bei meiner Steuerberatungsgesellschaft eine aufgelaufene u. noch aktuelle
Restschuld von ca. 3.000,– €.
In 2020 habe ich dort meine nun mögliche Bereitschaft zur Zahlung erklärt.
Die geforderte Summe habe ich beglichen.
Für die Jahre 2018 + 2019 ausstehende Steuererklärungen wurden nur unter der
Voraussetzung erstellt, dass ich je eine Pauschale vorauszahle.
Es wurde mir zugesichert, dass ein ggf. anfallender u. gezahlter Überschuss er-
stattet werden würde.
Nunmehr erfolgt Rechnungslegung u. es werden zusätzlich Gebührenpositionen
f. 2017 zusätzlich berechnet. Ohne frühere Geltendmachung. Ist das rechtens ?
ERbitte Ihre Auskunft.
Vielen Dank.
Renate Goebel – r.goebel.versicherungsvertrieb@t-online.de
PS: Meine Agentur habe ich aus Altersgründen (75) per 31.12.2019 aufgegeben.
Hallo Renate,
wir können und dürfen hier keine Rechtsauskunft geben, dafür müssten Sie bitte einen Profi beauftragen. Ob Gebühren berechnet werden dürfen, hängt vermutlich auch mit der Vereinbarung zusammen, die Sie mit Ihrer Steuerberatung getroffen haben.
Freundliche Grüße
Carolin von Bezahlen.net